Was ist ein guter, was ein schlechter Mensch? Im amerikanischen Kino und Fernsehen sehen wir oft eine simple Aufteilung in Gut und Böse. Eine Schwarz-Weiß-Ideologie, die das Genre-Kino prägt und uns in der Fiktion eine klare Orientierung bietet. Doch können wir dieses Gut-Böse-Denken auch in der amerikanischen Gesellschaft wiedererkennen? Ja. In diesem Essay erkunden wir, warum Fiktion und Realität gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie wir es uns oft wünschen.
Von Daniel Zemicael
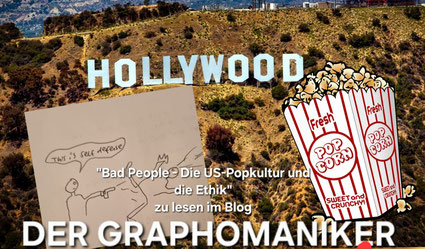
Die Vereinigten Staaten von Amerika werden oft als ein Sündenpfuhl wahrgenommen – eine zutiefst widersprüchliche, ja gar archaische Gesellschaft, in der sich nur die Stärkeren durchsetzen können. Trotz ihrer gewalttätigen Geschichte und Gegenwart spielt die Moral eine entscheidende Rolle als Orientierungshilfe für das gesellschaftliche Bestehen. Angesichts der gegenwärtigen Präsidentschaft mag diese Haltung äußerst heuchlerisch erscheinen. Amerika war schon immer gespalten: Das Land verherrlicht Gewalt, besteht aber gleichzeitig auf gutem Benehmen; es preist „gute Menschen“, duldet jedoch menschenverachtenden Rassismus. Auch die Popkultur und die Filmindustrie sind von dieser Ambivalenz nicht ausgenommen.
Die US-amerikanischen Genrefilme, die Gewalt als Stilmittel einsetzen, wie die „Equalizer-Trilogie“ mit Denzel Washington oder „Taken“ mit Liam Neeson, sind nicht grundlos so erfolgreich. Sie werden in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht als „krank“ oder „pervers“ wahrgenommen. Dieses Empfinden entsteht nicht aus dem Nichts, sondern ist – auch wenn sich Hollywood gegen diese Einordnung wehren würde – eine konsequente und konservative Widerspiegelung der „Auge-um-Auge“-Ideologie, die tief in der amerikanischen und teilweise christlich-fundamentalistischen Kultur verwurzelt ist.
Gesellschaft der Gesellschaftslosen
Brian Thompson war der CEO der US-amerikanischen Versicherungsgesellschaft „UnitedHealthcare“. Besonders bekannt war er für seine vielfältigen Kontroversen, vor allem dadurch, dass sein Unternehmen Leistungen für seine Versicherten größtenteils ablehnte und damit vielen US-Bürgern nachhaltig schadete. Negativ fiel am Ende auch der Einsatz eines KI-Modells aus, für das Thompson verantwortlich war. Das Unternehmen setzte diese Technologie ein, um Leistungsanträge von Patienten automatisch abzulehnen. Dabei verheimlichte Thompson, dass die KI mit einer Fehlerquote von zirka 90 Prozent eingesetzt wurde. Am 4. Dezember 2024 wurde Thompson vom jungen Luigi Mangione auf offener Straße erschossen.
Was dann folgte, war keine Hetzjagd auf den Mörder, sondern eine Welle der Sympathie gegenüber dem mutmaßlichen Täter. Die Nachricht ging wie ein Lauffeuer durch die Medien, und auf Social Media feierten die User Mangione. Viele junge Frauen schrieben, dass sie Mangione attraktiv fanden, andere tätowierten sein Gesicht sogar auf ihren Körper. T-Shirts und andere Merchandising-Produkte entstanden. Während Mangione mit Robin Hood oder sogar Jesus verglichen wurde, war das Mordopfer ein Mensch, der es verdient hat zu sterben.
Diese Art der Idealisierung eines Menschen, der auf eigene Faust für „Gerechtigkeit“ sorgt und dabei auch über Leichen geht, trifft in der US-Geschichte allerdings nicht erst seit diesem Fall einen Nerv. In Amerika ist die mythische Figur des „Lone Ranger“ ein Held. Weil das System ständig versagt, Gerechtigkeit der Korruption gewichen ist und der Kapitalismus die Bürger ausbeutet, aber die Reichen bevorzugt, muss es den Lone Ranger geben, der für sich selbst einsteht und für Gerechtigkeit sorgt. Dieses Bild des eigenverantwortlichen Individuums passt perfekt zur neoliberalen Ideologie.
Von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher kennen wir den Ausspruch „There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families“, doch auch Ronald Reagan propagierte diese Ideologie zeitgleich in Amerika. „Gesellschaft der Gesellschaftslosen“ nennt es Jean-Philippe Kindler in seiner herausragenden und erhellenden Kampfschrift „Scheiß auf Selflove, gib mir Klassenkampf“ und argumentiert damit gegen Thatcher und Reagan. Er meint, dass Neoliberale keine Politik mit Verantwortung betreiben wollen. Ihr Ziel ist es, die Bürger in der Weise zu manipulieren, dass diese denken sollen: „Wenn ich den Aufstieg in dieser Gesellschaft nicht schaffe, obwohl ich hart dafür gearbeitet habe, ist es einzig und allein meine Schuld.“
Dieses höchst problematische Denken ist tief in der DNA der amerikanischen Gesellschaft verankert. Hollywood-Stars treten auf Rednerpulten auf und propagieren, dass ihr Leben prekär begann, aber durch harte Arbeit ihr kometenhafter Aufstieg möglich war. Jeder kann es also schaffen, wenn er oder sie willens ist, alles zu geben. Dabei schaffen es in den USA nur vier Prozent, den sozialen Aufstieg zu bewältigen, die im unteren Einkommensquintil geboren wurden. 43 Prozent werden arm geboren und sterben arm.
„Jeder ist seines Glückes Schmied“. Konkurrenz belebt das Geschäft, also guckt jeder nur auf sich und versucht sein Bestes. Dass die Gesellschaft dabei kein Gemeinschaftsdenken entwickelt, wird gnadenlos übersehen. Außer den Blutsverwandten zählt nur das Individuum. Wie es aussieht, hat die neoliberale Ideologie Amerika voll im Griff. Eigenverantwortung wird in den USA also großgeschrieben. Und wehe, man weicht davon ab.
Deserves to die
Wer unmoralisch handelt, ist bereits ein schlechter Mensch, wer kriminell wird, muss ohne Gnade sanktioniert werden. Mörder sind Monster, Häftlinge mit der Todesstrafe haben ihr Menschsein verwirkt. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ist die Nation, die mit ihrem Menschenbild im Vergleich zum restlichen Westen äußerst eigentümlich umgeht. Man kann das toxische Menschenbild der USA in jeder Facette des Landes wiederfinden. Nehmen wir die Politik als großes Beispiel.
Im letzten Wahlkampf konnte man erkennen, dass es aus demokratischer und republikanischer Sicht um Gut und Böse ging, so betonten es deren Funktionäre. Dass es sich um gleichwertige Vertreter unterschiedlicher politischer Ideologien handelt, denen man mit Respekt begegnet, spielte in diesem Wahlkampf keine Rolle.
Dass beide Seiten so gut wie nichts gegen das große Problem der Ungleichheit im Land taten, scheint für die Bevölkerung offensichtlich keine Rolle zu spielen, da sie mit großer Mehrheit den skrupellosen Hyperkapitalisten Trump wieder einmal wählten. Trump scheint eine derartige Immunität im Land zu genießen, dass dieser sogar meinte, er könne jemanden auf offener Straße erschießen und käme damit davon.
Während Trump tun und lassen kann, was er will und trotz Vorstrafen und Verurteilung Präsident geworden ist, werden mittellose schwarze Mitbürger mit Vorstrafen gut und gerne für hundert Jahre eingesperrt. Diese ungerechten Unterschiede scheinen im Land von Milch und Honig kein großer Widerspruch zu sein. Amerika hat offensichtlich kognitive Dissonanzen, die zurecht in Europa und der restlichen Welt Kopfschütteln verursachen.
Richtig auf die Spitze getrieben wird Amerikas Gerechtigkeitssinn, wenn es um Menschenleben geht. Im Hollywoodfilm wird dem sogenannten Bösen immer das Handwerk gelegt, meist indem ihm das Leben genommen wird. Doch da die Unterhaltungsindustrie tief in die DNA der USA eingesickert ist, denkt die Bevölkerung, ein Mensch, der andere getötet hat, sollte wie im Film das Leben genommen werden. „He or she Deserves to die“ ist das Motto für die Abtrünnigen der Gesellschaft. So gibt es nach wie vor eine große Befürwortung der Todesstrafe. Nach dem Motto, je grausamer der Tod, desto gerechter ist es, kann man seit ein paar Jahren sogar Menschen mit Todesstrafe mit Giftgas staatlich ermorden.
Ethik, nicht Moral
Diese düsteren amerikanischen Verhältnisse greifen auf imperialistische Weise auf Europa über. Auch Deutschland ist stark betroffen. Filme mit ähnlichen Ideologien entstehen. Die rechtsextreme Partei AfD übernimmt immer mehr vom faschistischen Trump-Amerika. Auch in Deutschland gibt es einen Til Schweiger, der emotionalisiert herumtönt, dass ein Sexualstraftäter seinen Platz in der Gesellschaft verwirkt hätte.
Gut und Böse, schlechter und guter Mensch sind im Grunde Einstellungen eines Kindes, doch sie werden immer lauter. Comedian und Philosoph Florian Schröder schrieb in seinem lesenswerten Sachbuch „Unter Wahnsinnigen: Warum wir das Böse brauchen“, dass das Böse eine Kategorie der Religion sei, von der wir uns verabschieden sollten. Schon allein deswegen, da das sogenannte Böse mit dem Rest der Gemeinschaft nichts zu tun hätte. Schröder sagt, es gibt keine bösen, sondern nur schlechte Menschen und schlechte Taten. Dabei geht er so weit zu sagen, dass die schrecklichsten Straftaten zutiefst menschlich seien. Erst wenn wir Menschen begreifen, dass jeder in der Lage ist, Böses und Schreckliches zu begehen, lernen wir, uns auf andere Weise damit auseinanderzusetzen. Denn es ist wohl die schlimmste aller denkbaren Arten der Verdrängung, einen schlechten Menschen aus der Gemeinschaft auszusondern, ja gar zu ermorden, um sich davon zu distanzieren. Gerne wird dann mit der Moral argumentiert, die man eigentlich aus dem Märchen kennt, doch Moral ist eine überholte und nichtssagende Kategorie. Jeder kann seine eigene Moral haben, wie es im Film „Menschenfeind“ von Gasper Noe heißt.
Die Ethik zu wahren, ist der wahre Kern einer zivilisierten und aufgeklärten Gesellschaft. Wir müssen lernen, dass es nicht nur Gut oder Böse gibt. Menschen haben viele Facetten, und es existiert mehr als bloß Gut oder Schlecht, sondern Diverses und Vielschichtiges. Die Gesellschaft formt jedes Individuum, deshalb sollte man als Gemeinschaft nicht den blanken Individualismus preisen, sondern an das Gemeinwohl aller denken.

Kommentar schreiben